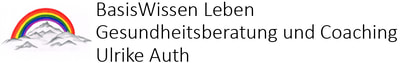Aktuelles
Von der Fast-nacht bis zur Fast-en-zeit
Ursprünge der Fastnacht
Schon sind sie wieder da, die "tollen Tage". Viele Menschen treibt es in dieser Zeit zu den Prunksitzungen und
Veranstaltungen der Karnevalsvereine - nicht nur in den Hochburgen der Fastnacht.
Gerne wird diese Zeit der Fastnacht auch die "fünfte" Jahreszeit genannt und beginnt mit dem 11.11. eines Jahres.
Höhepunkt des närrischen Treibens ist das letzte Wochenende vor dem Aschermittwoch, also vor dem Beginn der kirchlichen
Fastenzeit. War damit ursprünglich einmal der Dienstag vor dem Aschermittwoch (Fastnacht) gemeint, so breitete sich der Begriff
schnell aus und wurde auf die gesamte Zeitspanne übertragen.
Woher kommt dieser Brauch? Hat er uns vielleicht auch heute noch etwas zu sagen?
Das Brauchtum rund um Fastnacht und Karneval entwickelte sich in Deutschland möglicherweise im 11. Jahrhundert.
Genau zu diesem Zeitpunkt hatte die christliche Ausrichtung des Festes alte heidnische Formen verdrängt.
Eines der ältesten Zeugnisse über die Feier des Festabends in Kön stammt aus dem Jahr 1341.
Im Mittelalter war diese Fastenzeit ein radikaler Einschritt im Ablauf des Jahres. Neben dem Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte wie Milch, Butter, Käse,Schmalz und Eier gehörte auch das Gebot sexueller Enthaltsamkeit zur Fastenzeit.
Das führte dazu, dass in den Tagen vor der Fastenzeit nochmals Fleisch in größeren Mengen verzehrt wurde. Es galt auch die verderblichen Vorräte zu verwerten und so entstanden zum Beispiel die in Schmalz ausgebackenen, eierhaltigen Fastnachtsküchlein oder Krapfen.
So entwickelten sich die Fastnachtsbräuche bezogen auf Essen und Trinken also aus ökonomischen Gründen.
Wegen der bevorstehenden Enthaltsamkeit legten viele junge Paare ihre Hochzeitsnacht in die Fastnacht und der Tag vor dem
Aschermittwoch etablierte sich zum beliebten Hochzeitstermin.
Das gleiche galt für diverse Tanzveranstaltungen mit Paaren beiderlei Geschlechtes, bei welchen es nicht gerade prüde zuging.
Musik und Tanz wurden so zu einem wesentlichen Element dieser Tage.
Etwas später im 14. und 15. Jahrhunder kamen als neue Elemente Spiel- und Schaubräuche hinzu. Die Palette reichte von ernsthaften Wettkämpfen, über komische Turniere bis hin zu demonstrativen Vorführungen, Therateraufführungen und Umzügen.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kam es dann dazu, dass die Akteure zunehmends verkleidet und maskiert auftraten.
Weltliche und geistliche Obrigkeit begegnete dem Fastnachtstreiben zunächst weitgehend mit Toleranz - soweit die festgelegten Regeln eingehalten wurden.
Zu Ende des 15. Jahrhunderts trat seitens der theologischen Bewertung eine Wende ein. Die Bewertung der Fastnacht veränderte sich.
Ausschlaggebend dafür war die Zwei-Statten-Theorie des Kirchenlehrers Augustinus.
Wurde die Fastenzeit mit der "civitas dei" (Gottesstaat) gleichgesetzt, so interspretierte man die Fastnacht als "civitas diaboli" (Teufelsstaat). Logischerweise hatte dies Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Fastnacht.
Was die Verkleidung bis zu diesem Zeitpunkt beliebig gewesen, so tendierte sie nun hin zu Darstellungen von Negativgestalten. Man trat mit Teufelsmasken und Fratzen auf. Dieses Erscheinungsbild entsprach dann auch eher dem kirchlichen Verständnis der Fastnacht als Demonstration einer unheilvollen, verdrehten und von Gott entfernten Welt.
Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung kam es zur Entstehung einer neuen Fastnachtsfigur, die im Laufe der Zeit mehr und mehr zum Repräsentanten der Fastnacht schlechthin wurde: der Narr.
Heute versteht man unter einem Narren einen lustigen Menschen, einen Spaßmacher, Sprücheklopfer oder Possenreißer.
Die ursprüngliche Bedeutung war weiter gefaßt. Man verband mit dem Narren auch Dummheit, intellektuelle Beschränktheit, Blindheit im Geist sogar bis hin zu Geisteskrankheit. Erschwerend kam noch hinzu der Aspekt der Bösartigkeit, der Gottesverleugnung, ja sogar
der Erbsünde.
Alles in allem war der NARR sozusagen der Inbegriff einer falschen, umgedrehten und heillosen Welt.
Schon sind sie wieder da, die "tollen Tage". Viele Menschen treibt es in dieser Zeit zu den Prunksitzungen und
Veranstaltungen der Karnevalsvereine - nicht nur in den Hochburgen der Fastnacht.
Gerne wird diese Zeit der Fastnacht auch die "fünfte" Jahreszeit genannt und beginnt mit dem 11.11. eines Jahres.
Höhepunkt des närrischen Treibens ist das letzte Wochenende vor dem Aschermittwoch, also vor dem Beginn der kirchlichen
Fastenzeit. War damit ursprünglich einmal der Dienstag vor dem Aschermittwoch (Fastnacht) gemeint, so breitete sich der Begriff
schnell aus und wurde auf die gesamte Zeitspanne übertragen.
Woher kommt dieser Brauch? Hat er uns vielleicht auch heute noch etwas zu sagen?
Das Brauchtum rund um Fastnacht und Karneval entwickelte sich in Deutschland möglicherweise im 11. Jahrhundert.
Genau zu diesem Zeitpunkt hatte die christliche Ausrichtung des Festes alte heidnische Formen verdrängt.
Eines der ältesten Zeugnisse über die Feier des Festabends in Kön stammt aus dem Jahr 1341.
Im Mittelalter war diese Fastenzeit ein radikaler Einschritt im Ablauf des Jahres. Neben dem Verzicht auf Fleisch und andere tierische Produkte wie Milch, Butter, Käse,Schmalz und Eier gehörte auch das Gebot sexueller Enthaltsamkeit zur Fastenzeit.
Das führte dazu, dass in den Tagen vor der Fastenzeit nochmals Fleisch in größeren Mengen verzehrt wurde. Es galt auch die verderblichen Vorräte zu verwerten und so entstanden zum Beispiel die in Schmalz ausgebackenen, eierhaltigen Fastnachtsküchlein oder Krapfen.
So entwickelten sich die Fastnachtsbräuche bezogen auf Essen und Trinken also aus ökonomischen Gründen.
Wegen der bevorstehenden Enthaltsamkeit legten viele junge Paare ihre Hochzeitsnacht in die Fastnacht und der Tag vor dem
Aschermittwoch etablierte sich zum beliebten Hochzeitstermin.
Das gleiche galt für diverse Tanzveranstaltungen mit Paaren beiderlei Geschlechtes, bei welchen es nicht gerade prüde zuging.
Musik und Tanz wurden so zu einem wesentlichen Element dieser Tage.
Etwas später im 14. und 15. Jahrhunder kamen als neue Elemente Spiel- und Schaubräuche hinzu. Die Palette reichte von ernsthaften Wettkämpfen, über komische Turniere bis hin zu demonstrativen Vorführungen, Therateraufführungen und Umzügen.
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts kam es dann dazu, dass die Akteure zunehmends verkleidet und maskiert auftraten.
Weltliche und geistliche Obrigkeit begegnete dem Fastnachtstreiben zunächst weitgehend mit Toleranz - soweit die festgelegten Regeln eingehalten wurden.
Zu Ende des 15. Jahrhunderts trat seitens der theologischen Bewertung eine Wende ein. Die Bewertung der Fastnacht veränderte sich.
Ausschlaggebend dafür war die Zwei-Statten-Theorie des Kirchenlehrers Augustinus.
Wurde die Fastenzeit mit der "civitas dei" (Gottesstaat) gleichgesetzt, so interspretierte man die Fastnacht als "civitas diaboli" (Teufelsstaat). Logischerweise hatte dies Auswirkungen auf das Erscheinungsbild der Fastnacht.
Was die Verkleidung bis zu diesem Zeitpunkt beliebig gewesen, so tendierte sie nun hin zu Darstellungen von Negativgestalten. Man trat mit Teufelsmasken und Fratzen auf. Dieses Erscheinungsbild entsprach dann auch eher dem kirchlichen Verständnis der Fastnacht als Demonstration einer unheilvollen, verdrehten und von Gott entfernten Welt.
Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung kam es zur Entstehung einer neuen Fastnachtsfigur, die im Laufe der Zeit mehr und mehr zum Repräsentanten der Fastnacht schlechthin wurde: der Narr.
Heute versteht man unter einem Narren einen lustigen Menschen, einen Spaßmacher, Sprücheklopfer oder Possenreißer.
Die ursprüngliche Bedeutung war weiter gefaßt. Man verband mit dem Narren auch Dummheit, intellektuelle Beschränktheit, Blindheit im Geist sogar bis hin zu Geisteskrankheit. Erschwerend kam noch hinzu der Aspekt der Bösartigkeit, der Gottesverleugnung, ja sogar
der Erbsünde.
Alles in allem war der NARR sozusagen der Inbegriff einer falschen, umgedrehten und heillosen Welt.
Verkleiden und Masken tragen - nicht nur an Fastnacht

Fastnacht als die Zeit des maskierens und verkleidens.
Jedes kleine Mädchen träumt davon einmal Prinzessin oder Indianerin zu sein.
Viele Jungen träumen von Cowboys und Indianern auf wilden Pferden oder am Marterpfahl.
Auch der Clown ist ein beliebtes Motiv der Fastnacht.
Aber nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene flüchten sich gerne aus dem oft mit Sorgen, Ängsten und Zweifeln behafteten Alltag in diese "Scheinwelt auf Zeit".
Für ein paar Stunden oder Tage dem Alltag entfliehen - sich verstecken hinter Kostümen und Masken. Man möchte für kurze Zeit einfach nur etwas sein und/oder erleben, was im Alltag einfach
nicht möglich ist.
Musik, Tanz, lustige Theaterstückchen und vieles mehr werden uns präsentiert.
"Man" ist überschwenglich, fröhlich und schlägt durchaus auch einmal über die Stränge.
Alles wird nicht so ernst genommen und nicht gleich auf die Goldwaage gelegt.
Es zieht tausende von Menschen in die Prunksitzungen der Vereine, wo Helau und Alaf durch den Raum klingt, Lachen und Humor
angesagt ist. Viel Alkohol trägt dazu bei die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen.
Und dann am Rosenmontag der Höhepunkt des ganzen Treibens. Fastnachtsumzüge locken die Menschen auf die Straße.
"Man" scheint glücklich und in einer heilen Welt zu sein.
Aber bald vergeh'n die schönen Stunden ..... und es ist wieder Alltag, wieder Normalität, die Zeit des Erwachens.
Tragen wir denn wirklich nur an Fastnacht Kostüme und Masken?
Wie schaut es in unserem Leben aus?
Möchte ich meinen Mintmenschen zeigen, wie ich wirklich bin - was ich wirklich denke und fühle?
Ja, wir tragen auch im Alltag oft "Masken".
Sie sind uns zum zweiten Gesicht geworden.
Die folgende Meditation lässt uns hinübergleiten von der Fastnacht mit Maske in die Fastenzeit mit dem Schöpfer:
Ich maskiere mich, tue das, was man von mir erwartet, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle oder gar nicht so sein will.
Ich trage die Verkleidung eines selbstsicheren, routinierten Menschen.
In all den Jahren habe ich einfach gelernt, wie man es macht: die eigenen Schwächen zuzudecken und Gefühle zu verbergen.
Mein Gesicht ist glanzlos, stumpf, gefühllos und traurig geworden.
Ich lächle die Menschen an, aber mein Lachen ist nicht echt.
Ich lebe Sicherheit an den Tag, doch in Wahrheit spiele ich nur Theater.
Ständig tue ich so, als fiele mir alles in den Schoß, als irrte ich mich nie, als gäbe es keine heimlichen Sehnsüchte.
Warum nicht so sein, wie ich wirklich bin? Was hindert mich daran zu sein, was ich denke und fühle?
Ab und zu kann ich meine Maske auch mal abnehmen und so sein wie ich wirklich bin:
wenn ich alleine bin,
bei Menschen, denen ich vertraue.
Auch vor meinem Schöpfer brauche ich keine Masken, keine Schauspielerei, kein Verbiegen.
Er kennt mich mit allen Ecken und Kannten und "er liebt mich so, wie ich bin.
Er sagt ganz und gar "JA" zu mir.
Vor meinem Schöpfer kann ich die Maske fallenlassen und mich zeigen und anschauen lassen, wie ich bin.
Jedes kleine Mädchen träumt davon einmal Prinzessin oder Indianerin zu sein.
Viele Jungen träumen von Cowboys und Indianern auf wilden Pferden oder am Marterpfahl.
Auch der Clown ist ein beliebtes Motiv der Fastnacht.
Aber nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene flüchten sich gerne aus dem oft mit Sorgen, Ängsten und Zweifeln behafteten Alltag in diese "Scheinwelt auf Zeit".
Für ein paar Stunden oder Tage dem Alltag entfliehen - sich verstecken hinter Kostümen und Masken. Man möchte für kurze Zeit einfach nur etwas sein und/oder erleben, was im Alltag einfach
nicht möglich ist.
Musik, Tanz, lustige Theaterstückchen und vieles mehr werden uns präsentiert.
"Man" ist überschwenglich, fröhlich und schlägt durchaus auch einmal über die Stränge.
Alles wird nicht so ernst genommen und nicht gleich auf die Goldwaage gelegt.
Es zieht tausende von Menschen in die Prunksitzungen der Vereine, wo Helau und Alaf durch den Raum klingt, Lachen und Humor
angesagt ist. Viel Alkohol trägt dazu bei die Stimmung auf den Höhepunkt zu bringen.
Und dann am Rosenmontag der Höhepunkt des ganzen Treibens. Fastnachtsumzüge locken die Menschen auf die Straße.
"Man" scheint glücklich und in einer heilen Welt zu sein.
Aber bald vergeh'n die schönen Stunden ..... und es ist wieder Alltag, wieder Normalität, die Zeit des Erwachens.
Tragen wir denn wirklich nur an Fastnacht Kostüme und Masken?
Wie schaut es in unserem Leben aus?
Möchte ich meinen Mintmenschen zeigen, wie ich wirklich bin - was ich wirklich denke und fühle?
Ja, wir tragen auch im Alltag oft "Masken".
Sie sind uns zum zweiten Gesicht geworden.
Die folgende Meditation lässt uns hinübergleiten von der Fastnacht mit Maske in die Fastenzeit mit dem Schöpfer:
Ich maskiere mich, tue das, was man von mir erwartet, auch wenn ich mich gar nicht danach fühle oder gar nicht so sein will.
Ich trage die Verkleidung eines selbstsicheren, routinierten Menschen.
In all den Jahren habe ich einfach gelernt, wie man es macht: die eigenen Schwächen zuzudecken und Gefühle zu verbergen.
Mein Gesicht ist glanzlos, stumpf, gefühllos und traurig geworden.
Ich lächle die Menschen an, aber mein Lachen ist nicht echt.
Ich lebe Sicherheit an den Tag, doch in Wahrheit spiele ich nur Theater.
Ständig tue ich so, als fiele mir alles in den Schoß, als irrte ich mich nie, als gäbe es keine heimlichen Sehnsüchte.
Warum nicht so sein, wie ich wirklich bin? Was hindert mich daran zu sein, was ich denke und fühle?
Ab und zu kann ich meine Maske auch mal abnehmen und so sein wie ich wirklich bin:
wenn ich alleine bin,
bei Menschen, denen ich vertraue.
Auch vor meinem Schöpfer brauche ich keine Masken, keine Schauspielerei, kein Verbiegen.
Er kennt mich mit allen Ecken und Kannten und "er liebt mich so, wie ich bin.
Er sagt ganz und gar "JA" zu mir.
Vor meinem Schöpfer kann ich die Maske fallenlassen und mich zeigen und anschauen lassen, wie ich bin.
Die Fastenzeit
Mit dem Aschermittwoch beginnt in den christlich geprägten Ländern die 40-tägige Fastenzeit.
Es ist wieder eine Zeit der Vorsätze, des Verzichten und Umdenken wollens.
Der Staub des Aschekreuzes erinnert uns an die Vergänglichkeit.
Leben und Sterben existieren nebeneinander.
Ebenso Freude und Trauer, Licht und Dunkelheit, Völlerei und Fasten.
Die sogenannte "Fastenzeit" ist keine Neuzeitliche Erfindung. Zu allen Zeiten haben Menschen gefastet und verzichtet.
In der westlichen Kirche bezeichnet man den Zeitraum der 40-tägigen Vorbereitung auf das Osterfest als Fastenzeit.
Warum hat man hier gerade 40 Tage festgelegt, so wird sich manch einer Fragen.
Hintergrund hierfür ist z.B. auch das 40-tägige Fasten von Jesus in der Wüste. Sie erinnern aber ebenso an die 40 Tage der
Sintflut und die 40 Jahre, die das Volk Israel auf der Suche nach dem Hl. Land durch die Wüste zog.
Auch der Prophet Jona hatte eine Frist von 40 Tagen um das Volk von Ninive zu Umkehr und Buße zu bewegen.
Es ist wieder eine Zeit der Vorsätze, des Verzichten und Umdenken wollens.
Der Staub des Aschekreuzes erinnert uns an die Vergänglichkeit.
Leben und Sterben existieren nebeneinander.
Ebenso Freude und Trauer, Licht und Dunkelheit, Völlerei und Fasten.
Die sogenannte "Fastenzeit" ist keine Neuzeitliche Erfindung. Zu allen Zeiten haben Menschen gefastet und verzichtet.
In der westlichen Kirche bezeichnet man den Zeitraum der 40-tägigen Vorbereitung auf das Osterfest als Fastenzeit.
Warum hat man hier gerade 40 Tage festgelegt, so wird sich manch einer Fragen.
Hintergrund hierfür ist z.B. auch das 40-tägige Fasten von Jesus in der Wüste. Sie erinnern aber ebenso an die 40 Tage der
Sintflut und die 40 Jahre, die das Volk Israel auf der Suche nach dem Hl. Land durch die Wüste zog.
Auch der Prophet Jona hatte eine Frist von 40 Tagen um das Volk von Ninive zu Umkehr und Buße zu bewegen.

In früheren Zeiten waren von Natur aus "Fasten-Zeiten" vorgegeben. So zum Beispiel, wenn nach einem langen Winter die
Voräte zu Ende gegangen waren und draußen in der schneebedeckten Natur noch nichts Frisches zu finden war.
Da mussten die Menschen zwangsläufig fasten.
Und dies ist von der Natur sicherlich so vorgesehen, um den Körper von Schlacken und Giften reinigen zu können.
Im darauffolgenden Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben - der Stoffwechsel wird aktiver und die Schöpfung stellt uns jetzt jede Menge Pflanzen zur Verfügung, die eine körperliche Reinigung unterstützen.
So z,B, die Brennessel, den Löwenzahn, die Vogelmiere und andere mehr.
Voräte zu Ende gegangen waren und draußen in der schneebedeckten Natur noch nichts Frisches zu finden war.
Da mussten die Menschen zwangsläufig fasten.
Und dies ist von der Natur sicherlich so vorgesehen, um den Körper von Schlacken und Giften reinigen zu können.
Im darauffolgenden Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben - der Stoffwechsel wird aktiver und die Schöpfung stellt uns jetzt jede Menge Pflanzen zur Verfügung, die eine körperliche Reinigung unterstützen.
So z,B, die Brennessel, den Löwenzahn, die Vogelmiere und andere mehr.
In der heutigen Zeit gibt es bei uns in Europa solche Notzeiten nicht mehr. Viele Menschen sind weit weg von der Natur.
Vom 1. Januar bis zum 31. Dezember können wir in den Geschäften alles finden, was das Herz begehrt:
Gurken, Tomaten, Grüner Salat, Süßes, Salziges - eben alles.
Wo bleibt unserem Körper da die notwendige Zeit zur Reinigung?
Daher rückt in den letzten Jahren vermehrt wieder das "Heilfasten" in den Vordergrund.
Menschen verzichten für einen bestimmten Zeitraum auf feste Nahrung
- meist in Gruppen oder unter ärztlicher Aufsicht -
um
dem Körper wieder einmal die Möglichkeit zu geben sich zu entlasten.
Dazu gehört natürlich auch das ausreichende Trinken von gutem Wasser.
Da Körper und Geist eine Einheit bilden, wird auch der Geist klarer.
Oft werden diese Fastenkurse von Meditationen und Entspannungsübungen begleitet.
Ich selbst mache seit über 20 Jahren in jedem Frühjahr ein Heilfasten.
Startsignal ist für mich der Aschermittwoch. Ich verzichte auf feste Nahrung und nehme mir viel Zeit für mich selbst.
Zeit für meine Seele - Zeit um in meine Mitte zu finden, zu Gelassenheit, Geduld, Zufriedenheit, Selbst- und Nächstenliebe.
Wenn ich mit mir im Reinen bin und mich selbst von ganzem Herzen liebe, dann bekommt auch der Ausspruch von
Jesus "Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst" ganz andere Bedeutung.
Denn erst wenn ich in meiner Mitte bin kann ich das auch nach Außen an andere Weitergeben.
Ein leerer Wasserkrug ist nicht in der Lage lebensspendendes Wasser zu geben.
Von Tag zu Tag spürt man immer mehr Zufriedenheit und innere Klarheit.
Ein Erlebnis das sich lohnt - ich wage eine Begegnung mit MIR.
Doch dazu bedarf es einigen Mutes und auch einer gehörigen Portion Disziplin.
Wie viele Vorsätze werden am Aschermittwoch gefasst und sind oft schon nach 1-2 Wochen dahingeschmolzen.
Fastenzeit ist für mich mehr als nur der Verzicht auf Süßes, Alkohol, feste Nahrung und materielle Dinge.
Fastenzeit bedeutet für mich - sich wieder besinnen auf das Wesentliche.
In diesem Sinne kann ich euch allen nur empfehlen: Probiert es aus!
Es gibt nichts zu verlieren - ihr könnt nur gewinnen.
Nehmt euch dazu kleine Ziele vor und freut euch, wenn ihr sie erreicht habt und schaut dann auf das nächste Ziel.
Viel Spaß und viel Erfolg wünscht
Eure
Ulrike Auth